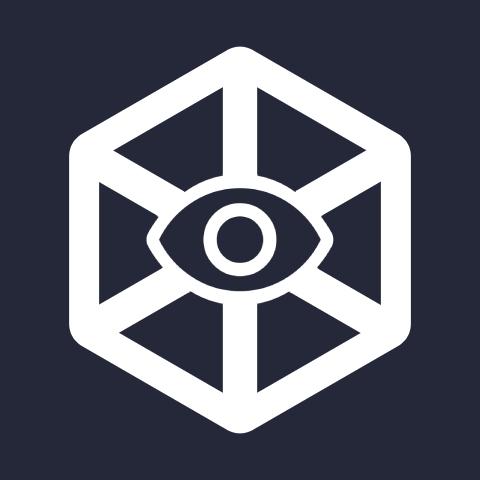Sichere Dir einen Platz im AI Bootcamp!
Mehr erfahrenSichere Dir einen Platz im AI Bootcamp!
Mehr erfahrenGenAI im Software Engineering: Wie Tech Leads KI sinnvoll in komplexen Systemen einsetzen
Wie können Unternehmen generative KI gewinnbringend in ihre Softwarelandschaften integrieren – insbesondere in komplexe oder gewachsene Systeme? Wir zeigen anhand praxisnaher Beispiele, wie GenAI den Unterschied macht: von schnellen Bug-Analysen in Millionenzeilen Code über smarte Tools für mehr Effizienz bis hin zur Stärkung des Teams durch gezielte Entlastung – ohne dabei den Menschen aus dem Mittelpunkt zu rücken.
von Tobias Nestler, Lesezeit: 10 Min.
GenAI in Software Engineering: Wie Tech Leads KI sinnvoll in komplexen Systemen einsetzen
Generative KI ermöglicht es, die Effizienz und Qualität der Softwareentwicklung entscheidend zu erhöhen. Insbesondere beim Umgang mit komplexen Altsystemen zeigt sich, dass moderne KI-gestützte Werkzeuge wertvolle Unterstützung bieten: Sie helfen, bestehende Strukturen zu analysieren, Code zu optimieren und wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren.
Praxisnahe Einblicke sowie eine Übersicht konkreter Tools veranschaulichen, wie sich GenAI sinnvoll im Entwicklungsalltag einsetzen lässt. Dabei spielt moderne Technologie eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, GenAI-Lösungen reibungslos in bestehende, häufig vielschichtige Systeme zu integrieren und für nachhaltigen Mehrwert zu sorgen.
Warum ich über GenAI in Legacy-Systemen spreche
Als ich beim Silicon Saxony Event in Görlitz über den Einsatz generativer KI im Software Engineering gesprochen habe, war mir eines besonders wichtig: keine Theorie zu präsentieren, sondern echte Anwendung zu vermitteln. Viele Tech Leads stehen heute vor der Herausforderung, generative KI in ihren bestehenden Systemen zu integrieren – ohne alles von Grund auf neu zu entwickeln.

Aus diesem Grund habe ich nicht über hypothetische Anwendungsfälle gesprochen, sondern gezeigt, wie GenAI bereits heute konkret unterstützen kann. Im Fokus standen Ansätze, mit denen sich GenAI strategisch in bestehende Systeme integrieren lässt, etwa bei der Bug-Analyse, beim Verständnis komplexer Codebasen oder für produktiveres Arbeiten in Legacy-Projekten.
Wo GenAI schon heute Produktivität freisetzt
Im Vortrag, den ich gemeinsam mit Maximilian Reichel von ZEISS Digital Innovation gehalten habe, ging es um die realistischen Chancen, aber auch klaren Grenzen generativer KI. Anhand konkreter Beispiele haben wir gezeigt:
- Weniger Zeit für Routine, mehr für Architektur: Tools wie GitHub Copilot entlasten Entwicklerinnen und Entwickler bei Standardaufgaben und steigern so die Produktivität in der Softwareentwicklung.
- Fehlersuche mit Kontext: KI kann helfen, Bugs deutlich schneller zu analysieren – vorausgesetzt, sie wird mit den richtigen Informationen versorgt.
- Wirksam auch in Legacy-Projekten: Mit einer durchdachten Strategie lassen sich selbst riesige und unübersichtliche Codebasen effizient mit GenAI auswerten.
All das ist längst keine Zukunftsmusik mehr, sondern bereits fester Bestandteil meines Arbeitsalltags. GenAI beeinflusst und optimiert zunehmend die Prozesse im Software Engineering.
Ein typischer Use Case: Bug-Analyse in Millionenzeilen Code
Ein Beispiel aus der Praxis: In einem Kundenprojekt, bei dem wir eng mit dem Auftraggeber zusammengearbeitet haben, wurde in einer Codebasis von über zwei Millionen Zeilen ein Bug gemeldet. Die manuelle Analyse wäre enorm zeitaufwendig, fehleranfällig und schwer skalierbar gewesen. Deshalb stellte sich die Frage: Wie lässt sich der Fehler mithilfe eines Large Language Models (LLM) eingrenzen, obwohl das Modell niemals die gesamte Codebasis auf einmal erfassen kann?
Unsere Antwort: Hierarchische Kontextstrategie
Um diese Herausforderung zu lösen, haben wir bei DevBoost ein eigenes Tool entwickelt. Es kommt ohne aufwendiges Fine-Tuning oder komplexes Prompt-Engineering aus. Der Schlüssel liegt in einer strukturierten Reduktion des Kontexts.

Datei-Ebene
Zunächst wird jede einzelne Datei analysiert, und relevante Codebestandteile – etwa Funktionssignaturen – werden extrahiert. Mithilfe eines LLM entsteht daraufhin eine kurze, verständliche Beschreibung der Funktionalität in der jeweiligen Datei. Das spart Tokens und verbessert die Suche für das LLM.
Modul-Ebene
Im nächsten Schritt werden die Dateibeschreibungen auf Modulebene gebündelt. So entsteht eine mehrstufige Repräsentation der gesamten Codebasis: von der Datei über das Modul bis hin zum Gesamtsystem. Datei → Modul → System.
Aufgabenbezug
Bei einer konkreten Aufgabenstellung prüft das LLM gezielt, welche Module und Dateien tatsächlich relevant sind. Nur diese werden dann vollständig in den Kontext geladen.
Das Ergebnis: Statt auf Vollständigkeit zu setzen, liegt der Fokus auf Relevanz und so entstehen verlässlich präzise Ergebnisse.
Warum klassische Tools oft an ihre Grenzen stoßen
Häufig greifen Entwicklerinnen und Entwickler bei solchen Aufgaben auf Tools wie Cline, aider oder Vektor-Suche zurück. In sehr großen Repositories stoßen diese Ansätze jedoch schnell an ihre Grenzen. Die Gründe dafür sind vielfältig:
- Die Verbindung zwischen Bug-Beschreibung und der tatsächlich betroffenen Datei ist oft nur schwach ausgeprägt.
- Die Codebasis ist zu umfangreich für eine umfassende Analyse mit herkömmlichen Werkzeugen.
- Das Kontextfenster aktueller LLMs reicht schlicht nicht aus, um alle relevanten Informationen gleichzeitig zu erfassen.
Gerade deshalb braucht es eine Strategie, die mit der Struktur des Codes arbeitet und nicht gegen sie.
Was mich überrascht hat: Wie robust einfache Strategien sein können
Was ich selbst besonders spannend finde: Für den produktiven Einsatz von GenAI (generative AI) sind weder perfekte Prompts noch aufwendiges Finetuning oder stundenlange Vorbereitungen nötig. Schon einfache, konsistente Zusammenfassungen und eine klare Kontextstrategie führen zu erstaunlich guten Ergebnissen.
- Effizienz entsteht durch gezielte Eingrenzung, nicht durch größtmögliche Detailtiefe.
- Gute Resultate lassen sich oft ohne manuelles Nachjustieren erzielen.
- Der größte Hebel liegt in der Frage: Was braucht das Modell wirklich, um helfen zu können?
Die wichtigsten Erfahrungen zeigen, dass nachhaltige und skalierbare Ansätze für den Einsatz von GenAI im Software Engineering tatsächlich möglich sind. Diese pragmatische Herangehensweise erweist sich in der Praxis häufig als wirkungsvoller als jede ausgetüftelte technische Spielerei.
Funktioniert auch in fremden Repositories
Die beschriebene Kontextstrategie für GenAI im Software Engineering bewährt sich in vielen Unternehmen selbst dort, wo niemand im Team das betreffende Softwareprojekt kennt – etwa bei externen GitHub-Repositories ohne Dokumentation und mit unklarer Struktur. Gerade im Bereich Softwareentwicklung ist die Herausforderung groß, veraltete oder fremde Codebasen effizient zu analysieren.
Wichtig ist, dass unterschiedliche Stakeholder in Unternehmen unterschiedliche Erwartungen an künstliche Intelligenz und die Einführung von KI Tools wie generative AI oder ChatGPT haben. Um in Software Engineering-Teams Akzeptanz zu schaffen, müssen diese Themen transparent kommuniziert und Vertrauen zu den eingesetzten Language Models aufgebaut werden.

Auch in Projekten, die auf den ersten Blick unüberschaubar wirken, etwa wenn eine Dokumentation fehlt oder komplexe Strukturen vorliegen, kann ein Large Language Model mit der richtigen Kontextstrategie erstaunlich präzise Ergebnisse liefern.
Das Modell erkennt die Ursachen von Fehlern, erklärt die Funktionsweise einzelner Module und zeigt auf, welche Auswirkungen bestimmte Änderungen am System haben könnten. Besonders im Software Engineering wird deutlich, wie effektiv generative KI und moderne KI-Tools für diese Analyseaufgaben eingesetzt werden können.
Genau diese Fähigkeit macht GenAI nicht nur zu einem Werkzeug für die Analyse in der Softwareentwicklung. Generative KI unterstützt auch beim Onboarding neuer Entwicklerinnen und Entwickler sowie bei der strukturierten Wissensweitergabe im Team. Damit wird aus einer technischen Lösung ein nachhaltiger Produktivitätsfaktor im Arbeitsalltag vieler Unternehmen und in anspruchsvollen Software-Engineering-Projekten.
Human-centricity und GenAI: Warum der Mensch im Mittelpunkt bleibt
Die Einführung von generativer KI in die Softwareentwicklung eröffnet für Unternehmen und Entwicklungsteams ganz neue Möglichkeiten, Prozesse zu verbessern und die Produktivität im Software Engineering nachhaltig zu erhöhen. Im Umgang mit KI-Tools, Large Language Models wie ChatGPT und automatisierter Codegenerierung ist die Begeisterung oft groß, doch eine wesentliche Erkenntnis bleibt:
Der Mensch bleibt das entscheidende Element jeder erfolgreichen Transformation.
Auch wenn Künstliche Intelligenz zunehmend Aufgaben im Software Development übernimmt, sind es immer noch Menschen, die Anforderungen formulieren, Entscheidungen treffen und die Richtung bestimmen. Requirements Engineering nimmt also eine entscheidende Rolle ein. Nur wenn die Anforderungen präzise definiert sind, lässt sich das Potenzial von GenAI nutzen, um Effizienz und Effektivität im Entwicklungsprozess nachhaltig zu steigern.
Human-centricity bedeutet, dass die Bedürfnisse, das Wissen und die Erfahrung von Softwareentwicklern und Software Engineers bei der Integration von GenAI und KI-Tools in den Entwicklungsprozess stets im Vordergrund stehen. Erfolgreiche Softwareentwicklung lebt davon, dass technologische Innovationen immer sinnvoll mit dem menschlichen Faktor verbunden werden.
Studien und Analysen aus verschiedenen Branchen zeigen, dass die besten Ergebnisse im Software Engineering erreicht werden, wenn menschliche Expertise und künstliche Intelligenz eng zusammenarbeiten. Generative KI eignet sich besonders gut für repetitive Aufgaben, etwa beim Schreiben von Boilerplate-Code oder bei der automatischen Aktualisierung von Dokumentationen. Entwicklerinnen und Entwickler hingegen behalten die Kontrolle über komplexe Entscheidungen, die Softwarearchitektur und die Qualitätssicherung.

Gerade im Bereich der Softwarequalität zeigt sich, welches Potenzial in dieser Zusammenarbeit steckt. KI-Tools können Fehlerquellen identifizieren, Optimierungsvorschläge unterbreiten und die Arbeit des Entwicklungsteams gezielt unterstützen. So entsteht eine Kombination aus technologischem Fortschritt und menschlicher Erfahrung, die den Erfolg von Softwareprojekten langfristig sichert.
Erst durch das Verständnis und die Bewertung durch Menschen wird aus einem KI-Vorschlag ein tatsächlicher Mehrwert für das Unternehmen. Die Kontrolle durch erfahrene Software Engineers (Human Oversight) bleibt unverzichtbar, damit die Ergebnisse den Anforderungen und Qualitätsstandards im jeweiligen Unternehmensumfeld entsprechen.
Ein weiteres zentrales Thema ist die Anpassung von KI-Tools an die konkreten Herausforderungen im Software Engineering. Besonders erfolgreich sind Unternehmen dann, wenn sie ihre Entwicklerinnen und Entwickler aktiv in die Auswahl und Weiterentwicklung von GenAI-Lösungen einbeziehen.
Auf diese Weise entstehen Tools, die nicht nur technologisch fortschrittlich sind, sondern auch die realen Abläufe und Aufgaben im Software-Development praxisnah unterstützen. Die kontinuierliche Einbindung von Fachexpertinnen und Experten sowie gezielte Weiterbildung im Umgang mit neuen Technologien sind wichtige Erfolgsfaktoren für eine langfristige und nachhaltige Transformation.
Die Integration von GenAI in den Softwareentwicklungsprozess ist weit mehr als ein rein technologischer Schritt. Sie markiert einen kulturellen Wandel, bei dem das Zusammenspiel von Mensch und künstlicher Intelligenz neu gestaltet wird. Unternehmen, die auf Human-centricity setzen, schaffen ein Arbeitsumfeld, in dem Teams ihre individuellen Stärken ausspielen und die Potenziale von KI gezielt für ihre Projekte im Software Engineering nutzen können.
Auch im Zeitalter der generativen KI bleibt der Mensch der zentrale Faktor, wenn es um Innovation, Qualität und nachhaltigen Erfolg in der Softwareentwicklung geht.
Mein Fazit für Tech Leads
Um GenAI erfolgreich in der Praxis zu nutzen, ist kein tiefes Spezialwissen über neuronale Netze oder komplexes Prompt Engineering erforderlich. Entscheidend ist vielmehr ein klar definierter Prozess, in den GenAI sinnvoll eingebettet wird. Der Anteil an generativer KI und KI-Tools im Markt für Softwareentwicklung steigt kontinuierlich und beeinflusst die Entwicklung verschiedener Software Engineering-Segmente weltweit.
In Regionen wie Europa, Nordamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum entstehen unterschiedliche Dynamiken und Potenziale, wenn es um den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Softwareentwicklung geht. Die Integration von modernen KI-Technologien und Large Language Models verändert die Branche grundlegend. Dadurch eröffnen sich neue Möglichkeiten im gesamten Entwicklungsprozess.
Ein Schwerpunkt liegt heute verstärkt auf Sprache und natürlichen Sprachschnittstellen, da GenAI menschenähnliche Kommunikation und intelligente Automatisierung im Softwareentwicklungsprozess ermöglicht. GenAI übernimmt eine immer zentralere Rolle im gesamten Software Development Lifecycle und fördert Innovationen sowie Effizienzsteigerungen in allen Phasen.
Für Softwareentwicklerinnen und Softwareentwickler bringt diese Entwicklung nachhaltige Veränderungen mit sich. Arbeitsweisen werden durch Automatisierung, neue Tools und die enge Zusammenarbeit mit KI-Systemen kontinuierlich weiterentwickelt und auf ein neues Niveau gehoben.
Praxistipps für den erfolgreichen Einsatz von GenAI
Strukturiere den Kontext
Eine klare, nachvollziehbare Ordnung im Code erleichtert es der künstlichen Intelligenz, relevante Informationen effizient zu verarbeiten. Dadurch wird die Analyse durch GenAI genauer und hilfreicher.
Fokussiere auf Relevanz, nicht Vollständigkeit
Es ist nicht notwendig, jedes Detail zu analysieren. Entscheidend ist, die wirklich relevanten Bereiche in der Softwareentwicklung in den Mittelpunkt zu stellen. So können große Datenmengen gezielt und sinnvoll genutzt werden.
Nutze GenAI gezielt zur Entlastung Deiner Teams
Besonders bei wiederkehrenden, aufwändigen Aufgaben entfaltet generative KI ihre Stärken. Sie automatisiert zeitintensive Prozesse und schafft so Raum für Kreativität und strategische Aufgaben.
Gerade in gewachsenen, komplexen Systemen sorgt diese Herangehensweise für einen echten Produktivitätsschub. Und das, ohne bestehende Architekturen grundlegend verändern zu müssen.
Neugierig geworden? Mehr zum Thema GenAI
Für alle, die GenAI in der Softwareentwicklung noch besser verstehen oder an eigenen Anwendungsfällen arbeiten möchten, bieten wir praxisnahe Formate, um den Einstieg zu erleichtern. Das AI Bootcamp richtet sich beispielsweise an Tech Leads aus der Produktentwicklung, die praxisbezogene Einblicke und Austausch auf Augenhöhe suchen.
Im Mittelpunkt stehen reale Use Cases, Diskussionen zu Herausforderungen aus dem Entwicklungsalltag sowie individuelle Deep-Dive-Sessions, bei denen spezifische Fragestellungen aufgegriffen werden. Das Programm ist flexibel – etwa auch als Inhouse-Workshop umsetzbar.
Unser AI Bootcamp im Überblick:
- 1 Tag Workshop mit Praxisbezug und realen Use Cases
- + individuelle Deep-Dive Session, abgestimmt auf Deinen Kontext
- Auch als Inhouse-Variante buchbar